Das neuste Buch des Walliser Schriftstellers Wilfried Meichtry* beleuchtet das Leben der Menschen im Oberwallis um die Mitte des 20. Jahrhunderts. Eine archaische Welt, geprägt von Naturgewalten, Machtstrukturen, kirchlichen und weltlichen, beherrschte den Alltag. Der Autor zeigt uns, wie sich die Menschen damals als Teil dieser Welt in ihrem Leben auf je eigene Weise zurechtfanden.
Gespräch: Robert Zemp
«pfarrblatt»: Nach der Lektüre ihres Romans «Nach oben sinken» sehen sich die Leser:innen in eine Welt versetzt, die der älteren Generation sehr vertraut ist. In den katholischen Gegenden der Schweiz hatte vor allem die Kirche das Sagen. Ihre Autorität wurde kaum angezweifelt. Warum interessieren Sie sich rückblickend für diese Zeit im Wallis?
Wilfried Meichtry: Als Historiker habe ich schon verschiedene Themen aus dem Wallis bearbeitet. Mich beschäftigen vor allem spannende Persönlichkeiten, die durch ihre Art zu leben und die Welt zu sehen, auffallen.
In meinem neusten Buch gehe ich nun zurück in die Zeit, als ich im Oberwallis jung war; ich möchte zeigen, wie ich diese Welt damals erlebte. Um das Atmosphärische des Zwischenmenschlichen und der Oberwalliser Landschaft erfahrbar und sichtbar zu machen, wählte ich für diesen Stoff die Form der Erzählung.
Inzwischen habe ich eine gewisse zeitliche Distanz zu meiner Jugendzeit, auch eine räumliche, ich lebe schon ein paar Jahrzehnte mit meiner Familie im Kanton Bern. Dennoch oder gerade deshalb möchte ich meinen Vorfahren eine Stimme geben, in ihre Welt eintauchen. Spannend finde ich die verschiedenen Lebenswelten, die schon damals im Oberwallis aufeinanderprallten: Die Kirche sah sich für das Seelenheil jedes Einzelnen verantwortlich und wachte über das Erfüllen religiöser Pflichten und Einhalten der zehn Gebote.
Dieses rigide System, das quasi den Teufel an die Wand malte, wurde unterschiedlich goutiert. Die einen beugten sich, andere retteten sich in die Scheinheiligkeit; es gab auch einzelne, die an der enge der kirchlichen Moral zerbrachen. Meine Grossmutter hingegen begegnete den Autoritäten, kirchlichen und weltlichen, auf Augenhöhe und dies mit viel Witz und Humor. Die selbstbewusste Frau hat Farbe ins Leben gebracht, geradezu etwas Zauberhaftes.
Ich selber war in diesem Umfeld als Jugendlicher neugierig, wollte es wissen und hinterfragte alles. Bücher waren mein Leben. So wurde der Blick geschärft, und allmählich merkte ich, dass das Leben mehr Fragen als Antworten für mich bereithielt. Dennoch suchte ich weiter nach dem Sinn und der Wahrheit des Lebens und eckte mit meiner hartnäckigen Fragerei oft an. Über viele Themen wurde nicht gesprochen, herrschte Schweigen. Dabei wäre so vieles zu klären und zu sagen gewesen, wie ich damals meinte.
Die Kirche sollte eigentlich dem Bild vom Baum entsprechen: Er hat tiefe Wurzeln, die Äste jedoch öffnen sich nach oben hin. Wir sind spirituelle Wesen mit einer Sehnsucht nach etwas Höherem.
Sie haben nun einen Roman geschrieben, der unter anderem von diesem Schweigen erzählt und ihm auf den Grund geht. Ihre Erzählung will rückblickend dieser Welt des Schweigens eine Stimme geben, sie im wörtlichen Sinn zur Sprache bringen. Ihr Text ist ein sehr persönlicher, eine Form von schreibendem Erinnern. Wie sind Sie vorgegangen?
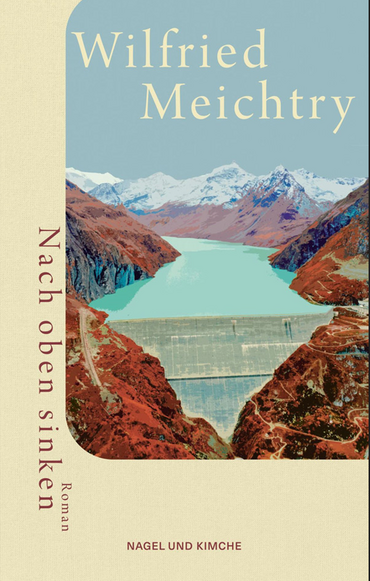
Mir war eine stimmige Atmosphäre wichtig, in der sich meine Personen bewegen. Auch der teils widrigen Umstände zum Trotz behalten einige ihren Witz und Humor, eine Art sprachliche Überlebensstrategie von damals, die mithalf, die verschiedenen Tabuzonen etwas anzukratzen. Ein Roman lebt auch von einer gewissen Spannung. Was eignete sich da besser als die Geschichte einer verbotenen Liebe, von der im Dorf niemand etwas weiss oder wissen will. Erst gegen Ende der Geschichte vermag der Ich-Erzähler das Geheimnis zu lüften, indem die ehemalige Geliebte das Schweigen bricht und rückblickend ihre glücklich-unglückliche Liebesgeschichte erzählt.
Obwohl die Wahrheit der zauberhaften Liebesbeziehung aufgedeckt wird, bleibt ein letztes Geheimnis zurück. Für den Ich-Erzähler ist diese Begegnung ein Urerlebnis von Kommunikation und gegenseitigem Verstehen. Er versteht nun besser, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Vor allem versteht er seine Eltern. Der Erzähler lässt die Leser:innen miterleben, wie er einmal Vater und Mutter bei ihrer gemeinsamen Arbeit beobachtet und gerührt mitansieht, wie sie sich miteinander ohne grosse Worte liebevoll begegnen.
Wichtig war mir, die Umstände der damaligen Zeit aus verschiedenen Perspektiven darzustellen. Ein Kind oder Jugendlicher erlebt die Welt anders als die Erwachsenen. Hier bleibt für mich auch ein gewisser atmosphärischer Zauber zurück, der mich bis heute begleitet. Meine Grossmutter war eine begnadete Erzählerin. Ihre Geschichten, ob wahr oder oft gut erfunden, jedoch mit Witz und Ironie erzählt, liessen ab und zu etwas von einer tieferen Wahrheit aufblitzen.
Erinnerungen sind an Emotionen gebunden, an das Atmosphärische. Wie hat sich zum Beispiel die Welt angefühlt, als ich 15 Jahre alt war? Durch das Wiedergeben des Atmosphärischen, von Stimmungen anhand exemplarischer Episoden wollte ich eine Art Resonanzraum schaffen, in dem für die Leser:innen je eigene Bilder entstehen. Und tatsächlich erhalte ich Rückmeldungen von vielen Leser:innen, die mir mitteilen, das sei eigentlich ihre Geschichte. Und so darf ich wohl sagen: Die Welt der Geschichten hat den grösseren Zauber als die Wirklichkeit.
Das Religiöse spielt in Ihrer Erzählung eine zentrale Rolle. Wie halten Sie´s mit der Religion?
Ich gebe zu, der Katholizismus, in dem ich aufgewachsen bin, hat mich geprägt. Die Fragen im Katechismus haben mich immer umgetrieben, waren viel wichtiger als die vorgegebenen Antworten. Auch die biblischen Geschichten, die unser Pfarrer erzählt hat, waren für mich Höhepunkte. Die Kernbotschaft von Jesus in der Bergpredigt mit der zutiefst menschlichen Botschaft ist heute noch wegweisend.
Was mich jedoch stört, ist das Machtgehabe der Kirche. Da menschelt es von morgens bis abends. Für die himmlischen Ideale sind wir Menschen nicht disponiert. Die Kirche sollte eigentlich dem Bild vom Baum entsprechen: Er hat tiefe Wurzeln, die Äste jedoch öffnen sich nach oben hin. Wir sind spirituelle Wesen mit einer Sehnsucht nach etwas Höherem.
Als Kind fühlte ich mich sehr geborgen in der damaligen Welt. Heute bin ich ein sogenannter Kulturchrist, verspüre immer noch den Zauber der kirchlichen Rituale, die ich als Kind miterleben durfte. Auch schätze ich Kirchenräume, die Stille, vielleicht auch die mystische Atmosphäre. Kirchen verweisen auf Antworten zu letzten Fragen wie: Woher komme ich und wohin gehe ich? Vielleicht auch zu letzten Wahrheiten.
* Wilfried Meichtry wurde 1965 in Leuk-Susten geboren. Er ist Historiker, Schriftsteller und Drehbuchautor. 1985 Matura am Kollegium Spiritus Sanctus in Brig, danach Studium der Germanistik an den Universitäten Fribourg und Bern. 1998 Dissertation zum Thema «Zwischen Ancien Régime und Moderne: Die Walliser Adelsfamilie von Werra». Er lebt mit seiner Familie in Burgdorf.
Zuletzt ist von Wilfried Meichtry erschienen: Nach oben sinken, Nagel & Kimche 2023, 256 S., Fr. 33.90. Weitere empfehlenswerte Werke: Mani Matter, literarische Biografie (2013). Verliebte Feinde, Iris und Peter von Roten, literarische Biografie (Neuauflage 2012). Die Welt ist verkehrt – nicht wir, Katharina von Arx und Freddy Drilhon (2015).

